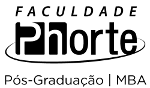81 resultados para generalisability
Resumo:
BACKGROUND: A pretrial clinical improvement project for the BOOST-II UK trial of oxygen saturation targeting revealed an artefact affecting saturation profiles obtained from the Masimo Set Radical pulse oximeter.
METHODS: Saturation was recorded every 10 s for up to 2 weeks in 176 oxygen dependent preterm infants in 35 UK and Irish neonatal units between August 2006 and April 2009 using Masimo SET Radical pulse oximeters. Frequency distributions of % time at each saturation were plotted. An artefact affecting the saturation distribution was found to be attributable to the oximeter's internal calibration algorithm. Revised software was installed and saturation distributions obtained were compared with four other current oximeters in paired studies.
RESULTS: There was a reduction in saturation values of 87-90%. Values above 87% were elevated by up to 2%, giving a relative excess of higher values. The software revision eliminated this, improving the distribution of saturation values. In paired comparisons with four current commercially available oximeters, Masimo oximeters with the revised software returned similar saturation distributions.
CONCLUSIONS: A characteristic of the software algorithm reduces the frequency of saturations of 87-90% and increases the frequency of higher values returned by the Masimo SET Radical pulse oximeter. This effect, which remains within the recommended standards for accuracy, is removed by installing revised software (board firmware V4.8 or higher). Because this observation is likely to influence oxygen targeting, it should be considered in the analysis of the oxygen trial results to maximise their generalisability.
Resumo:
Abstract and Summary of Thesis: Background: Individuals with Major Mental Illness (such as schizophrenia and bipolar disorder) experience increased rates of physical health comorbidity compared to the general population. They also experience inequalities in access to certain aspects of healthcare. This ultimately leads to premature mortality. Studies detailing patterns of physical health comorbidity are limited by their definitions of comorbidity, single disease approach to comorbidity and by the study of heterogeneous groups. To date the investigation of possible sources of healthcare inequalities experienced by individuals with Major Mental Illness (MMI) is relatively limited. Moreover studies detailing the extent of premature mortality experienced by individuals with MMI vary both in terms of the measure of premature mortality reported and age of the cohort investigated, limiting their generalisability to the wider population. Therefore local and national data can be used to describe patterns of physical health comorbidity, investigate possible reasons for health inequalities and describe mortality rates. These findings will extend existing work in this area. Aims and Objectives: To review the relevant literature regarding: patterns of physical health comorbidity, evidence for inequalities in physical healthcare and evidence for premature mortality for individuals with MMI. To examine the rates of physical health comorbidity in a large primary care database and to assess for evidence for inequalities in access to healthcare using both routine primary care prescribing data and incentivised national Quality and Outcome Framework (QOF) data. Finally to examine the rates of premature mortality in a local context with a particular focus on cause of death across the lifespan and effect of International Classification of Disease Version 10 (ICD 10) diagnosis and socioeconomic status on rates and cause of death. Methods: A narrative review of the literature surrounding patterns of physical health comorbidity, the evidence for inequalities in physical healthcare and premature mortality in MMI was undertaken. Rates of physical health comorbidity and multimorbidity in schizophrenia and bipolar disorder were examined using a large primary care dataset (Scottish Programme for Improving Clinical Effectiveness in Primary Care (SPICE)). Possible inequalities in access to healthcare were investigated by comparing patterns of prescribing in individuals with MMI and comorbid physical health conditions with prescribing rates in individuals with physical health conditions without MMI using SPICE data. Potential inequalities in access to health promotion advice (in the form of smoking cessation) and prescribing of Nicotine Replacement Therapy (NRT) were also investigated using SPICE data. Possible inequalities in access to incentivised primary healthcare were investigated using National Quality and Outcome Framework (QOF) data. Finally a pre-existing case register (Glasgow Psychosis Clinical Information System (PsyCIS)) was linked to Scottish Mortality data (available from the Scottish Government Website) to investigate rates and primary cause of death in individuals with MMI. Rate and primary cause of death were compared to the local population and impact of age, socioeconomic status and ICD 10 diagnosis (schizophrenia vs. bipolar disorder) were investigated. Results: Analysis of the SPICE data found that sixteen out of the thirty two common physical comorbidities assessed, occurred significantly more frequently in individuals with schizophrenia. In individuals with bipolar disorder fourteen occurred more frequently. The most prevalent chronic physical health conditions in individuals with schizophrenia and bipolar disorder were: viral hepatitis (Odds Ratios (OR) 3.99 95% Confidence Interval (CI) 2.82-5.64 and OR 5.90 95% CI 3.16-11.03 respectively), constipation (OR 3.24 95% CI 3.01-3.49 and OR 2.84 95% CI 2.47-3.26 respectively) and Parkinson’s disease (OR 3.07 95% CI 2.43-3.89 and OR 2.52 95% CI 1.60-3.97 respectively). Both groups had significantly increased rates of multimorbidity compared to controls: in the schizophrenia group OR for two comorbidities was 1.37 95% CI 1.29-1.45 and in the bipolar disorder group OR was 1.34 95% CI 1.20-1.49. In the studies investigating inequalities in access to healthcare there was evidence of: under-recording of cardiovascular-related conditions for example in individuals with schizophrenia: OR for Atrial Fibrillation (AF) was 0.62 95% CI 0.52 - 0.73, for hypertension 0.71 95% CI 0.67 - 0.76, for Coronary Heart Disease (CHD) 0.76 95% CI 0.69 - 0.83 and for peripheral vascular disease (PVD) 0.83 95% CI 0.72 - 0.97. Similarly in individuals with bipolar disorder OR for AF was 0.56 95% CI 0.41-0.78, for hypertension 0.69 95% CI 0.62 - 0.77 and for CHD 0.77 95% CI 0.66 - 0.91. There was also evidence of less intensive prescribing for individuals with schizophrenia and bipolar disorder who had comorbid hypertension and CHD compared to individuals with hypertension and CHD who did not have schizophrenia or bipolar disorder. Rate of prescribing of statins for individuals with schizophrenia and CHD occurred significantly less frequently than in individuals with CHD without MMI (OR 0.67 95% CI 0.56-0.80). Rates of prescribing of 2 or more anti-hypertensives were lower in individuals with CHD and schizophrenia and CHD and bipolar disorder compared to individuals with CHD without MMI (OR 0.66 95% CI 0.56-0.78 and OR 0.55 95% CI 0.46-0.67, respectively). Smoking was more common in individuals with MMI compared to individuals without MMI (OR 2.53 95% CI 2.44-2.63) and was particularly increased in men (OR 2.83 95% CI 2.68-2.98). Rates of ex-smoking and non-smoking were lower in individuals with MMI (OR 0.79 95% CI 0.75-0.83 and OR 0.50 95% CI 0.48-0.52 respectively). However recorded rates of smoking cessation advice in smokers with MMI were significantly lower than the recorded rates of smoking cessation advice in smokers with diabetes (88.7% vs. 98.0%, p<0.001), smokers with CHD (88.9% vs. 98.7%, p<0.001) and smokers with hypertension (88.3% vs. 98.5%, p<0.001) without MMI. The odds ratio of NRT prescription was also significantly lower in smokers with MMI without diabetes compared to smokers with diabetes without MMI (OR 0.75 95% CI 0.69-0.81). Similar findings were found for smokers with MMI without CHD compared to smokers with CHD without MMI (OR 0.34 95% CI 0.31-0.38) and smokers with MMI without hypertension compared to smokers with hypertension without MMI (OR 0.71 95% CI 0.66-0.76). At a national level, payment and population achievement rates for the recording of body mass index (BMI) in MMI was significantly lower than the payment and population achievement rates for BMI recording in diabetes throughout the whole of the UK combined: payment rate 92.7% (Inter Quartile Range (IQR) 89.3-95.8 vs. 95.5% IQR 93.3-97.2, p<0.001 and population achievement rate 84.0% IQR 76.3-90.0 vs. 92.5% IQR 89.7-94.9, p<0.001 and for each country individually: for example in Scotland payment rate was 94.0% IQR 91.4-97.2 vs. 96.3% IQR 94.3-97.8, p<0.001. Exception rate was significantly higher for the recording of BMI in MMI than the exception rate for BMI recording in diabetes for the UK combined: 7.4% IQR 3.3-15.9 vs. 2.3% IQR 0.9-4.7, p<0.001 and for each country individually. For example in Scotland exception rate in MMI was 11.8% IQR 5.4-19.3 compared to 3.5% IQR 1.9-6.1 in diabetes. Similar findings were found for Blood Pressure (BP) recording: across the whole of the UK payment and population achievement rates for BP recording in MMI were also significantly reduced compared to payment and population achievement rates for the recording of BP in chronic kidney disease (CKD): payment rate: 94.1% IQR 90.9-97.1 vs.97.8% IQR 96.3-98.9 and p<0.001 and population achievement rate 87.0% IQR 81.3-91.7 vs. 97.1% IQR 95.5-98.4, p<0.001. Exception rates again were significantly higher for the recording of BP in MMI compared to CKD (6.4% IQR 3.0-13.1 vs. 0.3% IQR 0.0-1.0, p<0.001). There was also evidence of differences in rates of recording of BMI and BP in MMI across the UK. BMI and BP recording in MMI were significantly lower in Scotland compared to England (BMI:-1.5% 99% CI -2.7 to -0.3%, p<0.001 and BP: -1.8% 99% CI -2.7 to -0.9%, p<0.001). While rates of BMI and BP recording in diabetes and CKD were similar in Scotland compared to England (BMI: -0.5 99% CI -1.0 to 0.05, p=0.004 and BP: 0.02 99% CI -0.2 to 0.3, p=0.797). Data from the PsyCIS cohort showed an increase in Standardised Mortality Ratios (SMR) across the lifespan for individuals with MMI compared to the local Glasgow and wider Scottish populations (Glasgow SMR 1.8 95% CI 1.6-2.0 and Scotland SMR 2.7 95% CI 2.4-3.1). Increasing socioeconomic deprivation was associated with an increased overall rate of death in MMI (350.3 deaths/10,000 population/5 years in the least deprived quintile compared to 794.6 deaths/10,000 population/5 years in the most deprived quintile). No significant difference in rate of death for individuals with schizophrenia compared with bipolar disorder was reported (6.3% vs. 4.9%, p=0.086), but primary cause of death varied: with higher rates of suicide in individuals with bipolar disorder (22.4% vs. 11.7%, p=0.04). Discussion: Local and national datasets can be used for epidemiological study to inform local practice and complement existing national and international studies. While the strengths of this thesis include the large data sets used and therefore their likely representativeness to the wider population, some limitations largely associated with using secondary data sources are acknowledged. While this thesis has confirmed evidence of increased physical health comorbidity and multimorbidity in individuals with MMI, it is likely that these findings represent a significant under reporting and likely under recognition of physical health comorbidity in this population. This is likely due to a combination of patient, health professional and healthcare system factors and requires further investigation. Moreover, evidence of inequality in access to healthcare in terms of: physical health promotion (namely smoking cessation advice), recording of physical health indices (BMI and BP), prescribing of medications for the treatment of physical illness and prescribing of NRT has been found at a national level. While significant premature mortality in individuals with MMI within a Scottish setting has been confirmed, more work is required to further detail and investigate the impact of socioeconomic deprivation on cause and rate of death in this population. It is clear that further education and training is required for all healthcare staff to improve the recognition, diagnosis and treatment of physical health problems in this population with the aim of addressing the significant premature mortality that is seen. Conclusions: Future work lies in the challenge of designing strategies to reduce health inequalities and narrow the gap in premature mortality reported in individuals with MMI. Models of care that allow a much more integrated approach to diagnosing, monitoring and treating both the physical and mental health of individuals with MMI, particularly in areas of social and economic deprivation may be helpful. Strategies to engage this “hard to reach” population also need to be developed. While greater integration of psychiatric services with primary care and with specialist medical services is clearly vital the evidence on how best to achieve this is limited. While the National Health Service (NHS) is currently undergoing major reform, attention needs to be paid to designing better ways to improve the current disconnect between primary and secondary care. This should then help to improve physical, psychological and social outcomes for individuals with MMI.
Resumo:
Einleitung: Zu den autistischen Syndromen werden der frühkindliche Autismus (Kanner-Syndrom), das Asperger-Syndrom und atypische Autismusformen oder nicht-spezifizierte tiefgreifende Entwicklungsstörungen gezählt. Bei den autistischen Syndromen liegen Beeinträchtigungen (1) der Kommunikation und (2) der sozialen Interaktion vor. Weiterhin weisen (3) die Kinder in unterschiedlichem Maß stereotypes, repetitives Verhalten auf und haben bestimmte Sonderinteressen. Verhaltensbasierte Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus basieren auf lerntheoretischen und verhaltenstherapeutischen Konzepten. Sie berücksichtigen die besonderen vorliegenden Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung, der emotionalen Reaktionen, der sozialen Interaktionen sowie der Kommunikationsmuster. Die systematische Anwendung und Evaluation solcher Modelle in Deutschland ist aber bisher eher die Ausnahme. Fragestellungen: - Wie sind die gesundheitliche Effektivität und Sicherheit von verhaltens- oder fertigkeitenbasierten Frühinterventionen bei autistischen Syndromen untereinander und verglichen mit einer Standardbehandlung? - Gibt es Hinweise auf besondere Wirkfaktoren für die Effektivität? - Wie ist die Kosten-Effektivität? - Wie hoch sind die Kosten der verschiedenen Interventionen? - Lassen sich aus ethischen und rechtlichen Überlegungen Schlüsse für die Anwendung der betrachteten Interventionen bei Betroffenen mit autistischem Syndrom in der Praxis ziehen? Methoden: Basierend auf einer systematischen Literaturrecherche werden ab 2000 in deutscher oder englischer Sprache veröffentlichte kontrollierte Studien zu verhaltens- oder fertigkeitenbasierten Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus im Alter von bis zu zwölf Jahren eingeschlossen und bewertet. Die Mindestzahl an Studienteilnehmern muss zehn pro Interventionsgruppe betragen. Ergebnisse: Insgesamt 15 Veröffentlichungen klinischer Primärstudien, acht systematische Reviews und eine ökonomische Veröffentlichung erfüllen die Einschlusskriterien. Die meisten Studien evaluieren intensive Frühinterventionen, die sich an das Modell von Lovaas (Early intensive behavioural treatment (EIBT), Applied behavioural analysis (ABA)) anlehnen. Einige Studien evaluieren andere Interventionen, die teilweise pragmatisch waren und teilweise einem bestimmten Modell folgen (spezifisches Elterntraining, Responsive education and prelinguistic milieu teaching (RPMT), Joint attention (JA) und symbolisches Spielen (SP), Picture exchange communication system (PECS)). Verhaltensanalytische Interventionen basierend auf dem Lovaas-Modell können weiterhin als die am besten empirisch abgesicherten Frühinterventionen angesehen werden. Vorschulkinder mit Autismus können durch verhaltensbasierte Interventionen mit einer Mindestintensität von 20 Stunden pro Woche Verbesserungen in kognitiven und funktionalen Bereichen (expressive Sprache, Sprachverständnis und Kommunikation) erreichen. Es bleibt jedoch unklar, welche Mindestintensität notwendig ist, und welche Wirkkomponenten für die Ergebnisse verantwortlich sind. Für andere umfassende Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus liegt keine hochwertige Evidenz vor. Die für den ökonomischen Teilbereich identifizierte und einbezogene Publikation ist methodisch und thematisch nicht dazu geeignet, die Fragen nach der Kosten-Effektivität oder den Kostenwirkungen von Frühinterventionen beim Autismus auch nur ansatzweise zu beantworten. Publikationen zu rechtlichen, ethischen oder sozialen Aspekten werden nicht identifiziert. Die finanzielle Lage der Betroffenen und der Familien wird durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (Pf-WG) verbessert. Weitere rechtliche Belange betreffen die Betreuung und die Deliktfähigkeit der Menschen mit Autismus. Auch die gleichheitliche Betreuung und Versorgung sind insbesondere vor dem Hintergrund der Pflege im häuslichen Umfeld eine wichtige Frage. Diskussion: Es gibt nur wenige methodisch angemessene Studien zur Beurteilung der Wirksamkeit von Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus. Die meisten Studien sind vergleichsweise kurz und haben teilsweise kein verblindetes Ergebnis-Rating. Der Mangel an hochwertigen vergleichenden Studien lässt keine solide Antwort auf die Frage zu, welche Frühintervention bei welchen Kindern mit Autismus am wirksamsten ist. Programme nach dem Lovaas-Modell scheinen am wirkungsvollsten zu sein. Dies gilt vor allem, wenn sie klinikbasiert durchgeführt werden. Zu einzelnen Wirkfaktoren von Frühinterventionen nach dem ABA-Modell konnte allerdings keine solide Evidenz gefunden werden. Es zeigte sich, dass ein Elterntraining hinsichtlich der Verbesserung der Kommunikation besser ist als eine Routinebehandlung, in der eine Mischung von Theapieelementen angewendet wird. Sowohl für die klinischen als auch die gesundheitsökonomischen Studien besteht das Problem unzureichender Verallgemeinerbarkeit der Studienergebnisse in den deutschen Versorgungskontext. Die ökonomischen Studien sind methodisch und thematisch nicht dazu geeignet die aufgeworfenen Fragestellungen zu beantworten. Schlussfolgerung: Basierend auf der derzeitigen Studienlage liegt für keine der untersuchten verhaltensbasierten Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus ausreichende Evidenz vor. Die in diesem Bericht ausgewerteten Studien und Reviews legen nahe, dass Vorschulkinder mit Autismus durch verhaltensbasierte Interventionen mit einer Mindestintensität von 20 Stunden pro Woche Verbesserungen in kognitiven und funktionalen Bereichen erreichen können. Es gibt bisher keine Hinweise, dass bei einem substantiellen Anteil der Kinder eine vollständige Normalisierung der Entwicklung erreicht werden kann. Die meiste Evidenz liegt für die ABA vor. Ein Minimum an erforderlicher oder sinnvoller Behandlungsintensität kann jedoch nicht angegeben werden. Eine professionelle Umsetzung eines verhaltensbasierten Frühinterventionsprogrammes in engem und ausführlichem Kontakt mit den Kindern und unter Einbeziehung der Eltern erscheint sinnvoll. Zur Kosten-Effektivität von intensiven Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus können keine validen Angaben gemacht werden. Effektive Frühinterventionen könnten jedoch die Gesamtkosten des Autismus langfristig reduzieren, indem die anfallenden hohen Aufwendungen durch eine spätere bessere soziale Anpassung überkompensiert werden.
Resumo:
Hintergrund: Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist eine häufige und potenziell tödliche Erkrankung mit einer Lebenszeitprävalenz von über 20%. Allein in Deutschland wird die Zahl der durch die ischämische Herzerkrankung und des akuten Myokardinfarkts jährlich verursachten Todesfälle auf etwa 140.000 geschätzt. Ein Zusammenhang eng mit dem Lebensstil verbundener Risikofaktoren mit Auftreten und Prognose der KHK ist nachgewiesen. Durch Maßnahmen der nichtmedikamentösen Sekundärprävention wird versucht, diese Risikofaktoren positiv zu verändern sowie die KHK im Gegensatz zu palliativen interventionellen Therapiestrategien kausal zu behandeln. Zur Wirksamkeit der nichtmedikamentösen sekundärpräventiven Maßnahmen liegt eine ganze Reihe von Einzelstudien und -untersuchungen vor, eine systematische Analyse, die die Evidenz aller hauptsächlich angewandten Sekundärpräventionsstrategien zusammenfasst, fehlt unseres Wissens nach bislang jedoch. Auch eine Auswertung vorhandener Studien zur Kosten-Effektivität der Maßnahmen ist hierbei zu integieren. Fragestellung: Ziel dieses HTA-Berichts (HTA=Health Technology Assessment) ist die Erstellung einer umfassenden Übersicht der aktuellen Literatur zu nichtmedikamentösen Sekundärpräventionsmaßnahmen in der Behandlung der KHK, um diese Maßnahmen und deren Komponenten bezüglich ihrer medizinischen Wirksamkeit sowie Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Weiterhin sollen die ethischen, sozialen und rechtlichen Aspekte der nichtmedikamentösen Sekundärprävention und die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den deutschen Versorgungsalltag untersucht werden. Methodik: Relevante Publikationen werden über eine strukturierte und hochsensitive Datenbankrecherche sowie mittels Handrecherche identifiziert. Die Literaturrecherche wird in vier Einzelsuchen zu medizinischen, gesundheitsökonomischen, ethischen und juristischen Themen am 18.09.2008 durchgeführt und erstreckt sich über die vergangenen fünf Jahre. Die methodische Qualität der Publikationen wird von jeweils zwei unabhängigen Gutachtern unter Beachtung von Kriterien der evidenzbasierten Medizin (EbM) systematisch geprüft. Ergebnisse: Von insgesamt 9.074 Treffern erfüllen 43 medizinische Publikationen die Selektionskriterien, mit einem Nachbeobachtungszeitraum zwischen zwölf und 120 Monaten. Insgesamt ist die Studienqualität zufriedenstellend, allerdings berichtet nur ca. die Hälfte der Studien differenziert die Gesamtmortalität, während die übrigen Studien andere Outcomemaße verwenden. Die Wirksamkeit einzelner Sekundärpräventionsmaßnahmen stellt sich als sehr heterogen dar. Insgesamt kann langfristig eine Reduktion der kardialen sowie der Gesamtmortalität und der Häufigkeit kardialer Ereignisse sowie eine Erhöhung der Lebensqualität beobachtet werden. Vor allem für trainingsbasierte und multimodale Interventionen ist eine effektive Reduktion der Mortalität zu beobachten, während psychosoziale Interventionen besonders in Bezug auf eine Erhöhung der Lebensqualität effektiv zu sein scheinen. Für die ökonomischen Auswertungen werden 26 Publikationen identifiziert, die von ihrer Themenstellung und Studienart dem hier betrachteten Kontext zugeordnet werden können. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Studienlage zur multimodalen Rehabilitation sowohl bezüglich ihrer Menge als auch Qualität der Analysen besser darstellt, als dies für Evaluationen von Einzelmaßnahmen beobachtet werden kann. Die internationale Literatur bestätigt den multimodalen Ansätzen dabei zwar ein gutes Verhältnis von Kosten und Effektivität, untersucht jedoch nahezu ausschließlich ambulante oder häuslichbasierte Maßnahmen. Die Auswertung der Studien, die einzelne sich mit präventiven Maßnahmen in Hinblick auf ihre Kosten-Effektivität beschäftigen, ergibt lediglich positive Tendenzen für Interventionen der Raucherentwöhnung und des körperlichen Trainings. Im Hinblick auf psychosoziale Maßnahmen sowie auch die Ernährungsumstellung können aufgrund der unzureichenden Studienlage jedoch keine Aussagen über die Kosten-Effektivität getroffen werden. Insgesamt werden im Rahmen der Betrachtung sozialer Aspekte der nichtmedikamentösen Sekundärprävention elf Publikationen einbezogen. Die relativ neuen Studien bestätigen, dass Patienten mit niedrigem sozioökonomischen Status insgesamt schlechtere Ausgangsbedingungen und demnach einen spezifischen Bedarf an rehabilitativer Unterstützung haben. Gleichzeitig sind sich die Forscher jedoch uneinig, ob gerade diese Patientengruppe relativ häufiger oder seltener an den Rehabilitationsmaßnahmen teilnimmt. Bezüglich der Barrieren, die Patienten von der Teilnahme an den präventiven Maßnahmen abhalten, werden psychologische Faktoren, physische Einschränkungen aber auch gesellschaftliche und systemisch-orientierte Einflüsse genannt. Diskussion: Nichtmedikamentöse Sekundärpräventionsmaßnahmen sind sicher und in der Lage eine Reduktion der Mortalität sowie der Häufigkeit kardialer Ereignisse zu erzielen sowie die Lebensqualität zu erhöhen. Da nur wenige der methodisch verlässlichen Studien Teilnehmer über einen längeren Zeitraum von mindestens 60 Monaten nachverfolgen, müssen Aussagen über die Nachhaltigkeit als limitiert angesehen werden. Verlässliche Angaben in Bezug auf relevante Patientensubgruppen lassen sich nur sehr eingeschränkt machen ebenso wie im Hinblick auf die vergleichende Beurteilung verschiedener Maßnahmen der Sekundärprävention, da diese von eingeschlossenen Studien nur unzureichend erforscht wurden. Zukünftige methodisch verlässliche Studien sind notwendig, um diese Fragestellungen zu untersuchen und zu beantworten. Bezogen auf die Kosten-Effektivität nichtmedikamentöser sekundärpräventiver Maßnahmen kann aus den internationalen Studien eine insgesamt positive Aussage zusammengefasst werden. Einschränkungen dieser resultieren jedoch zum einen aus den Besonderheiten des deutschen Systems der stationären Rehabilitationsangebote, zum anderen aus den qualitativ mangelhaften Evaluationen der Einzelmaßnahmen. Studien mit dem Ziel der Bewertung der Kosten-Effektivität stationärer Rehabilitationsangebote sind ebenso erforderlich wie auch qualitativ hochwertige Untersuchungen einzeln erbrachter Präventionsmaßnahmen. Aus sozialer Perspektive sollte insbesondere untersucht werden, welche Patientengruppe aus welchen Gründen von einer Teilnahme an Rehabilitations- bzw. präventiven Maßnahmen absieht und wie diesen Argumenten begegnet werden könnte. Schlussfolgerung: Nichtmedikamentöse sekundärpräventive Maßnahmen sind in der Lage eine Reduktion der Mortalität und der Häufigkeit kardialer Ereignisse zu erzielen sowie die Lebensqualität zu erhöhen. Eine Stärkung des Stellenwerts nichtmedikamentöser Maßnahmen der Sekundärprävention erscheint vor diesem Hintergrund notwendig. Auch kann für einige Interventionen ein angemessenes Verhältnis von Effektivität und Kosten angenommen werden. Es besteht allerdings nach wie vor erheblicher Forschungsbedarf bezüglich der Wirksamkeitsbeurteilung nichtmedikamentöser Maßnahmen der Sekundärprävention in wichtigen Patientensubgruppen und der Effizienz zahlreicher angebotener Programme. Darüber hinaus ist weitere Forschung notwendig, um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen und Gründe für die Nichtinanspruchnahme detailliert zu untersuchen. Vor allem gilt es jedoch den Versorgungsalltag in Deutschland, wie er sich für Ärzte, Patienten und weitere Akteure des Gesundheitswesens darstellt, zu untersuchen und den heutigen Stellenwert nichtmedikamentöser Maßnahmen aufzuzeigen.
Resumo:
Objectives. Recent literature indicates variance in psychosocial treatment preferences for negative symptoms of schizophrenia. Attempts at defining therapeutic aims and outcomes for negative symptoms to date have not included major stakeholder groups. The aim of the present study was to address this gap through qualitative methods. Design. Thematic Analysis was applied to qualitative semi-structured interview data to gather the opinions of people who experience negative symptoms, carers, and healthcare professionals. Participants were recruited from two mental health sites (inpatient/community) to increase generalisability of results. Ten people participated in the research. Methods. Semi-structured interview scripts were designed utilising evidence from the review in Chapter 1 of effective psychosocial intervention components for specific negative symptoms. Interviews were audio recorded and transcribed verbatim. Thematic analysis was employed to analyse data. Results. A common theme across groups was the need for a personalised approach to intervention for negative symptoms. Other themes indicated different opinions in relation to treatment targets and the need for a sensitive and graded approach to all aspects of therapy. This approach needs to be supported across systemic levels of organisation with specific training needs for staff addressed. Conclusions. There is disparity in treatment preferences for negative symptoms across major stakeholders. The findings suggest an individualised approach to intervention of negative symptoms that is consistent with recovery. Implementation barriers and facilitators were identified and discussed. There remains a need to develop a better understanding of treatment preferences for patients.
Resumo:
OBJECTIVE: Current data about the prevalence and characteristics of dizziness in the paediatric population is very limited and the generalisability of extant studies to the UK population has not been explored. Our study aims to provide a robust estimate of the prevalence of dizziness in 10 year old children in the UK, to describe the characteristics of this dizziness and to explore whether this dizziness is socially patterned. METHODS: Data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) was analysed (N=13,988). A total of 6965 of these children attended for a balance assessment session at age 10. Those who reported rotary vertigo were interviewed about their symptoms. Logistic regression was used to explore whether dizziness at age 10 is socially patterned. RESULTS: A total of 400 children reported rotary vertigo, giving a prevalence estimate of 5.7% [CI 5.2, 6.3%]. 13.1-20.6% of children reported experiencing their dizziness between 1 and 4 times a week (depending on the symptom). 51.5% of children had to stop what they were doing because of the dizziness making them feel unwell. A total of 60% of children reported headache as an accompanying symptom, tentatively suggesting a diagnosis of migraine, although there was no association between reports of headache and a maternal family history of migraine. 20.3% of children with dizziness also reported tinnitus and 17.3% reported that their hearing changed when they were dizzy. CONCLUSIONS: Dizziness in 10 year old children is not uncommon and in about half limits current activities. Rotary vertigo is commonly accompanied by dizziness of another description and also by headache. There is no evidence that dizziness at this age is socially patterned.