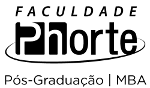880 resultados para Heroin users
Resumo:
OBJECTIVES: To estimate the prevalence of youth who use cannabis but have never been tobacco smokers and to assess the characteristics that differentiate them from those using both substances or neither substance. DESIGN: School survey. SETTING: Postmandatory schools. PARTICIPANTS: A total of 5263 students (2439 females) aged 16 to 20 years divided into cannabis-only smokers (n = 455), cannabis and tobacco smokers (n = 1703), and abstainers (n = 3105). OUTCOME MEASURES: Regular tobacco and cannabis use; and personal, family, academic, and substance use characteristics. RESULTS: Compared with those using both substances, cannabis-only youth were younger (adjusted odds ratio [AOR], 0.82) and more likely to be male (AOR, 2.19), to play sports (AOR, 1.64), to live with both parents (AOR, 1.33), to be students (AOR, 2.56), and to have good grades (AOR, 1.57) and less likely to have been drunk (AOR, 0.55), to have started using cannabis before the age of 15 years (AOR, 0.71), to have used cannabis more than once or twice in the previous month (AOR, 0.64), and to perceive their pubertal timing as early (AOR, 0.59). Compared with abstainers, they were more likely to be male (AOR, 2.10), to have a good relationship with friends (AOR, 1.62), to be sensation seeking (AOR, 1.32), and to practice sports (AOR, 1.37) and less likely to have a good relationship with their parents (AOR, 0.59). They were more likely to attend high school (AOR, 1.43), to skip class (AOR, 2.28), and to have been drunk (AOR, 2.54) or to have used illicit drugs (AOR, 2.28). CONCLUSIONS: Cannabis-only adolescents show better functioning than those who also use tobacco. Compared with abstainers, they are more socially driven and do not seem to have psychosocial problems at a higher rate.
Resumo:
Many studies based on either an experimental or an epidemiological approach, have shown that the ability to drive is impaired when the driver is under the influence of cannabis. Baseline performances of heavy users remain impaired even after several weeks of abstinence. Symptoms of cannabis abuse and dependence are generally considered incompatible with safe driving. Recently, it has been shown that traffic safety can be increased by reporting the long-term unfit drivers to the driver licensing authorities and referring the cases for further medical assessment. Evaluation of the frequency of cannabis use is a prerequisite for a reliable medical assessment of the fitness to drive. In a previous paper we advocated the use of two thresholds based on 11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THCCOOH) concentration in whole blood to help to distinguish occasional cannabis users (≤3μg/L) from heavy regular smokers (≥40μg/L). These criteria were established on the basis of results obtained in a controlled cannabis smoking study with placebo, carried out with two groups of young male volunteers; the first group was characterized by a heavy use (≥10 joints/month) while the second group was made up of occasional users smoking at most 1 joint/week. However, to date, these cutoffs have not been adequately assessed under real conditions. Their validity can now be evaluated and confirmed with 146 traffic offenders' real cases in which the whole blood cannabinoid concentrations and the frequency of cannabis use are known. The two thresholds were not challenged by the presence of ethanol (40% of cases) and of other therapeutic and illegal drugs (24%). Thus, we propose the following procedure that can be very useful in the Swiss context but also in other countries with similar traffic policies: if the whole blood THCCOOH concentration is higher than 40μg/L, traffic offenders must be directed first and foremost toward medical assessment of their fitness to drive. This evaluation is not recommended if the THCCOOH concentration is lower than 3μg/L and if the self-rated frequency of cannabis use is less than 1 time/week. A THCCOOH level between these two thresholds cannot be reliably interpreted. In such a case, further medical assessment and follow-up of the fitness to drive are also suggested, but with lower priority.
Resumo:
Rekapitulation der Thesen und Ergebnisse In den nachfolgenden Abschnitten werden zur besseren Übersicht nochmals die zentralen Gesichtspunkte der Untersuchung und der wichtigsten Resultate zusammengefasst Zum Schluss werden die Untersuchungsergebnisse noch unter dem Blickwinkel ihrer praktischen Konsequenzen für die Umsetzung einzelner drogenpolitischer Zielsetzungen ausgewertet und die Problembereiche identifiziert, welche zusätzliche Forschungsanstrengungen erforderlich machen A Theoriebildung und Forschungsansatz Die Untersuchung verwendet einen multimodalen methodischen Ansatz (direkte Befragung Strafaktenanalyse und Auswertung amtlicher Statistiken) zur Analyse typischer Anpassungsmechanismen und konkreter Handlungsstrategien als Reaktion auf den behördliche Repression des lokalen Drogenmarktgeschehens Sie fokussiert auf den Kreis regelmäßiger Heroin und/oder Kokainkonsumenten die sich zeitweilig an bekannten Treffpunkten der sogenannten <
Resumo:
Background: The objective of this study was to determine if mental health and substance use diagnoses were equally detected in frequent users (FUs) compared to infrequent users (IUs) of emergency departments (EDs). Methods: In a sample of 399 adult patients (>= 18 years old) admitted to a teaching hospital ED, we compared the mental health and substance use disorders diagnoses established clinically and consigned in the medical files by the ED physicians to data obtained in face-to-face research interviews using the Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) and the Alcohol, Smoking and Involvement Screening Test (ASSIST). Between November 2009 and June 2010, 226 FUs (>4 visits within a year) who attended the ED were included, and 173 IUs (<= 4 visits within a year) were randomly selected from a pool of identified patients to comprise the comparison group. Results: For mental health disorders identified by the PRIME-MD, FUs were more likely than IUs to have an anxiety (34 vs. 16%, Chi2(1) = 16.74, p <0.001), depressive (47 vs. 25%, Chi2(1) = 19.11, p <0.001) or posttraumatic stress (PTSD) disorder (11 vs. 5%, Chi2(1) = 4.87, p = 0.027). Only 3/76 FUs (4%) with an anxiety disorder, 16/104 FUs (15%) with a depressive disorder and none of the 24 FUs with PTSD were detected by the ED medical staff. None of the 27 IUs with an anxiety disorder, 6/43 IUs (14%) with a depressive disorder and none of the 8 IUs with PTSD were detected. For substance use disorders identified by the ASSIST, FUs were more at risk than IUs for alcohol (24 vs. 7%, Chi2(1) = 21.12, p <0.001) and drug abuse/dependence (36 vs. 25%, Chi2(1) = 5.52, p = 0.019). Of the FUs, 14/54 (26%) using alcohol and 8/81 (10%) using drugs were detected by the ED physicians. Of the IUs, 5/12 (41%) using alcohol and none of the 43 using drugs were detected. Overall, there was no significant difference in the rate of detection of mental health and substance use disorders between FUs and IUs (Fisher's Exact Test: anxiety, p = 0.567; depression, p = 1.000; PTSD, p = 1.000; alcohol, p = 0.517; and drugs, p = 0.053). Conclusions: While the prevalence of mental health and substance use disorders was higher among FUs, the rates of detection were not significantly different for FUs vs. IUs. However, it may be that drug disorders among FUs were more likely to be detected.
Resumo:
OBJECTIVE: The aim of the study was to validate a French adaptation of the 5th version of the Addiction Severity Index (ASI) instrument in a Swiss sample of illicit drug users. PARTICIPANTS AND SETTING: The participants in the study were 54 French-speaking dependent patients, most of them with opiates as the drug of first choice. Procedure: Analyses of internal consistency (convergent and discriminant validity) and reliability, including measures of test-retest and inter-observer correlations, were conducted. RESULTS: Besides good applicability of the test, the results on composite scores (CSs) indicate comparable results to those obtained in a sample of American opiate-dependent patients. Across the seven dimensions of the ASI, Cronbach's alpha ranged from 0.42 to 0.76, test-retest correlations coefficients ranged from 0.48 to 0.98, while for CSs, inter-observer correlations ranged from 0.76 to 0.99. CONCLUSIONS: Despite several limitations, the French version of the ASI presents acceptable criteria of applicability, validity and reliability in a sample of drug-dependent patients.
Resumo:
It was observed in the city of Salvador, State of Bahia, the highest seroprevalence of human T cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-I) infection in Brazil as demonstrated by national wide blood bank surveys. In this paper, we report results of an investigation of drug use and sexual behavior associated with HTLV-I infection among male and female injecting drug users (IDUs) in Salvador. A cross sectional study was conducted in the Historical District of Salvador from 1994-1996 (Projeto Brasil-Salvador) and 216 asymptomatic IDUs were selected using the snowball contact technique. Blood samples were collected for serological assays. Sera were screened for human immunodeficiency virus (HIV-1/2) and HTLV-I/II antibodies by ELISA and confirmed by Western blot. The overall prevalence of HTLV-I/II was 35.2% (76/216). The seroprevalence of HTLV-I, HTLV-II and HIV-1 was for males 22%, 11.3% and 44.1% and for females 46.2%, 10.3% and 74.4% respectively. HTLV-I was identified in 72.4% of HTLV positive IDUs. Variables which were significantly associated with HTLV-I infection among males included needle sharing practices, duration of injecting drug use, HIV-1 seropositivity and syphilis. Among women, duration of injecting drug use and syphilis were strongly associated with HTLV-I infection. Multivariate analysis did not change the direction of these associations. Sexual intercourse might play a more important role in HTLV-I infection among women than in men.
Resumo:
Background: Simultaneous polydrug use (SPU) may represent a greater incremental risk factor for human health than concurrent polydrug use (CPU). However, few studies have examined these patterns of use in relation to health issues, particularly with regard to the number of drugs used. Methods: In the present study, we have analyzed data from a representative sample of 5734 young Swiss males from the Cohort Study on Substance Use Risk Factors. Exposure to drugs (i.e., alcohol, tobacco, cannabis, and 15 other illicit drugs), as well as mental, social and physical factors, were studied through regression analysis. Results: We found that individuals engaging in CPU and SPU followed the known stages of drug use, involving initial experiences with licit drugs (e.g., alcohol and tobacco), followed by use of cannabis and then other illicit drugs. In this regard, two classes of illicit drugs were identified, including first uppers, hallucinogens and sniffed drugs; and then "harder" drugs (ketamine, heroin, and crystal meth), which were only consumed by polydrug users who were already taking numerous drugs. Moreover, we observed an association between the number of drugs used simultaneously and social issues (i.e., social consequences and aggressiveness). In fact, the more often the participants simultaneously used substances, the more likely they were to experience social problems. In contrast, we did not find any relationship between SPU and depression, anxiety, health consequences, or health. Conclusions: We identified some associations with SPU that were independent of CPU. Moreover, we found that the number of concurrently used drugs can be a strong factor associated with mental and physical health, although their simultaneous use may not significantly contribute to this association. Finally, the negative effects related to the use of one substance might be counteracted by the use of an additional substance.
Resumo:
L'article publié de le cadre de cette thèse est intitulé "Effectiveness of interventions targeting frequent users of emergency departments: A systematic review." Il a été publié par les "Annals of Emergency Medicine (AEM)" en juillet 2011. Le titre en français pourrait être: "Efficacité des interventions ciblant les utilisateurs fréquents des services d'urgence: Une revue systématique." Le titre du journal américain pourrait être: "Annales de Médecine d'Urgence". Il s'agit du journal du "Collège Américain des Médecins d'Urgence", en anglais "American College of Emergency Physicians (ACEP)". L'article a été soumis à l'AEM en raison de l'intérêt que ses rédacteurs en chef portent pour le sujet des utilisateurs fréquents des services d'urgence, démontré depuis plus de dix ans par la publication de nombreux articles dans ce domaine. Le facteur d'impact de l'AEM est de surcroît le plus important des journaux d'urgence, assurant ainsi une large diffusion des articles publiés. Lors de sa publication, l'article a été accompagné d'un éditorial signé par le Docteur Maria C. Raven, médecin au Centre Hospitalier de Bellevue à New York, Etats-Unis.¦Contexte et enjeux¦La Direction Générale du Centre Hospitalier Vaudois (CHUV) finance, dans le cadre du plan stratégique 2009-2013, un axe "populations vulnérables". Cet axe est porté en grande partie par des projets développés au sein de la Policinlique Médicale Universitaire et l'Unité des Populations Vulnérables qui prend en charge, enseigne la prise en charge et s'interroge sur la prise en charge des personnes les plus vulnérables. C'est dans ce contexte que nous avons été amenés à réfléchir à l'existence éventuelle de marqueurs de vulnérabilité; l'utilisation fréquente des services d'urgence par certains individus constitue à n'en pas douter l'un de ces marqueurs. Il existe une importante littérature décrivant en détail ces utilisateurs fréquents des services d'urgence, raison pour laquelle nous avons décidé de faire un pas supplémentaire et de nous interroger sur l'efficacité des interventions (quelle qu'elles soient) ciblant cette population particulière. Nous avons ainsi entrepris une revue systématique de la littérature scientifique médicale et sociale pour approfondir cette question, et c'est précisément le résultat de cette recherche qui constitue ce travail de thèse.¦Conclusions et perspectives¦Les utilisateurs fréquents des services d'urgence sont des individus particulièrement vulnérables, et ce aussi bien aux Etats-Unis, qu'en Europe ou en Australie: ils présentent par exemple une mortalité supérieure aux autres utilisateurs des urgences; ils sont également plus à risque de présenter une consommation abusive d'alcool ou de drogues, une maladie mentale, ou une maladie chronique. Ils sont plus souvent sans abri, sans assurance et d'un statut socio-économique bas.¦De nombreuses interventions on été développées pour prendre en charge les utilisateurs fréquents des urgences. Le but de ces interventions est d'une part de réduire la consommation des services d'urgence et d'autre part d'améliorer la santé au sens large de ces patients vulnérables. C'est en ces termes (réduction de la fréquence d'utilisation des services d'urgence et amélioration de la santé) que l'efficacité d'une intervention est mesurée.¦Parmi l'ensemble des interventions étudiées, l'une semble particulièrement efficace pour réduire le nombre de visites aux urgences et améliorer un certain nombre de marqueurs sociaux (accès à un logement ou à une assurance-maladie). Cette intervention est appelée "case management" (ou "gestion de cas", difficile tentative de traduction de ce concept en français), et consiste en une approche multidisciplinaire (médecins, infirmiers, assistants sociaux) fournissant un service individualisé, dans le cadre de l'hôpital et souvent également dans la communauté. L'approche consiste à évaluer les besoins précis du patient, à l'accompagner dans son parcours de soin, à l'orienter si nécessaire et à mettre en place autour de lui un réseau communiquant de manière adaptée.¦Le "case management" ayant montré son efficacité dans la prise en charge des utilisateurs fréquents des services d'urgence, y-compris en termes de coûts, notre conclusion va dans le sens d'encourager les hôpitaux à évaluer l'importance de ce phénomène dans leur propre pratique et à mettre en place des équipes de prise en charge de ces patients, dans le double but de soutenir des patients particulièrement vulnérables et de réduire la consommation des services d'urgence. Suite à la réflexion suscitée par ce travail de thèse, une telle équipe a été mise en place en 2010, dans un cadre de recherche-action, au niveau du CHUV. Ce projet est dirigé par le Dr Patrick Bodenmann, responsable de l'Unité Populations Vulnérables de la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne. Le Dr Bodenmann est également le directeur de cette thèse et le dernier auteur de la revue systématique.
Resumo:
Summary of the findings for 2005/06 from the four collaborating centres in Northen Ireland
Resumo:
Survey of Injecting Drug Users: Summary of the findings for 2004/05 from the four collaborating centres in Northern Ireland
Resumo:
Shooting Up: Infections among injecting drug users in the United Kingdom - Northern Ireland Summary
Resumo:
Summary of the findings for 2003/04 in Northern Ireland